Kompass für den Frieden gesucht
Frieden: Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ringen Christen um eine angemessene Positionierung in der Friedensfrage. Für die einen ist der Pazifismus eine überholte Position. Andere bringen gerade jetzt die Logik des »gerechten Friedens« ins Spiel.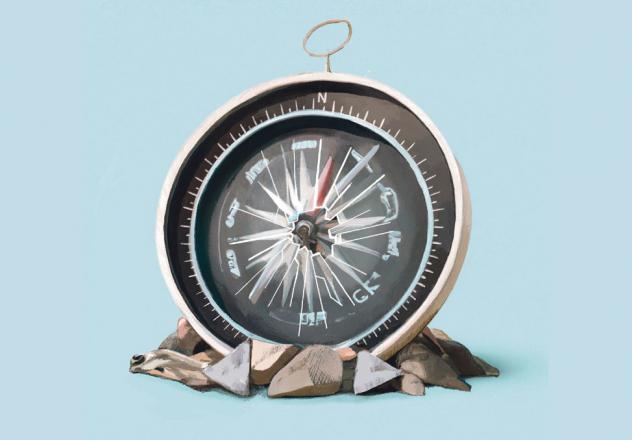
Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist oft zu vernehmen, die bisherige tendenziell eher pazifistische Positionierung der evangelische Kirche halte der Realität nicht mehr stand und gehöre angepasst. Bisher galt die Friedenskundgebung der EKD-Synode 2019 in Dresden als »letzter Stand« in der Friedensethik: dass die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg zugunsten eines Leitbilds vom gerechten Frieden verabschiedet wird: »Das Leitbild des gerechten Friedens setzt die Gewaltfreiheit an die erste Stelle. (…) Wir rufen die politisch Verantwortlichen dazu auf, militärische Gewalt und kriegerische Mittel zu überwinden. Vom Gerechten Frieden her zu denken heißt, den Grundsatz zu befolgen: ›Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor.‹ Deshalb setzen wir uns mit ganzer Kraft für die Vorbeugung und Eindämmung von Gewalt ein.«
Doch heute stehen sich dem früheren EKD-Friedensbeauftragten Renke Brahms zufolge zwei gegensätzliche friedensethische Positionierungen in der Kirche gegenüber: Eine, die nach wie vor am Vorrang der Gewaltfreiheit festhält und beispielsweise Waffenlieferungen ablehnt; und eine, die die Situation gegeben sieht, dass rechtserhaltende Gewalt als nun letztmögliches Mittel angewendet werden soll. Doch Brahms betont in seinem Buch »Allein der Frieden«: »Beide müssen ihre Dilemmata offenlegen.« Die Letztgenannten müssten mit den Folgen eskalierender Gewalt und vielen Toten umgehen, »die ein solcher Einsatz unweigerlich mit sich bringt«. Und die anderen müssten damit umgehen, dass sich das Volk der Ukraine ohne weitere Stärkung ihrer Verteidigungskräfte dem »Diktat Russlands« ergeben müsste. Brahms plädiert für eine offene Diskussion, in dem sich die unterschiedlichen Positionen »im gegenseitigen Respekt als gemeinsames Ringen um einen gerechten Frieden« verstehen.
Das Aushalten des Dilemmas ist auch für Johannes Wischmeyer, leitender Theologe im Kirchenamt der EKD, der gegenwärtig geeignetste Ausdruck evangelischer Friedensethik. In seinem Beitrag für das Buch »Friedensethik in Kriegszeiten« schreibt er: »Gefragt ist eine Sprache, die unauflösbare Dilemmasituationen in der Wirklichkeit des Krieges auf den Punkt bringt, die Leidens- und Mitleidenserfahrungen aufnimmt und sich nicht scheut, das Böse ›böse‹ zu nennen.« Die kirchlich Verantwortlichen warnt er davor, in ihren Äußerungen zu stark das Feld der Politik zu betreten und rät dazu, »im Zweifel auf tagesaktuelle friedenspolitische Botschaften getrost einmal zu verzichten«. Wischmeyer betont die vorrangig karitativen und seelsorgerlichen Aufgaben der Kirche auch im Umgang mit dem Krieg. Wichtig sei vor allem, »dass Christen für den Frieden beten und tatkräftig den vor den Kriegsfolgen Geflüchteten wie den im Kriegsgebiet Ausharrenden zur Seite stehen, auch wenn sich der Konflikt in die Länge ziehen sollte«. Entscheidend sei, dass »sich Menschen inmitten ihrer Zukunftssorgen von der Friedensverheißung des christlichen Glaubens bestärkt und getragen fühlen«.
Traditionell versucht die Basisbewegung der Ökumenischen Friedensdekade seit 1980 Orientierung zu bieten für das christliche Friedenszeugnis in den Fragen der jeweiligen Zeit. Dafür stehen die beiden Friedensboten der diesjährigen Friedensdekade, der Liedermacher Konstantin Wecker und die ehemalige Osnabrücker Bürgermeisterin Lioba Meyer. Für Meyer ist es ein dringendes Anliegen, die Botschaft der kürzlich verstorbenen Politikerin und Theologin Antje Vollmer weiterzutragen, die kurz vor ihrem Tod als letzte Mahnung diese Worte hinterließ: »Wer die Welt wirklich retten will, diesen kostbaren einzigartigen wunderbaren Planeten, der muss den Hass und den Krieg gründlich verlernen. Wir haben nur diese eine Zukunftsoption.« Und Konstantin Wecker schreibt in seinem Impulstext: »Als Antimilitarist und Pazifist bin ich fest davon überzeugt, dass nur eine internationale Friedens- und Antikriegsbewegung diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putins Machtapparat gegen die Menschen in der Ukraine stoppen kann.« Laut Mitorganisator Thomas Oelerich wolle die Friedensdekade »den Friedensbewegten in Kirche und Gesellschaft wieder Mut machen, auch weiterhin grundsätzliche (An-)Fragen an das vorherrschende militärische Sicherheitsdenken in Politik und Gesellschaft zu stellen« und das zunehmende militaristische Denken zu hinterfragen. Er fragt: »Selbst wenn es irgendwann ›einen Sieger‹ auf dem Schlachtfeld geben sollte: Hat etwas so Zerstörerisches, das so unzählige Menschenleben kostet, die Bezeichnung ›Erfolg‹ verdient?«
Auch den Krieg im Nahen Osten nimmt die Friedensdekade in den Blick. In einem Gebetstext auf der Internetseite heißt es: »Ich bete für alle, die im Nahen Osten jetzt Gewalt leiden an Körper und Seele. Ich bete für alle, die durch Angriffe verletzt werden. Ich bete für die Getöteten und ihre Angehörigen. Ich bete für alle, die in Bunker und an geschützte Orte geflüchtet sind. Ich bitte für alle, die das Dröhnen der Raketen und Drohnen nicht ertragen. Ich bete für die Kinder in Israel und Palästina. Ich bete für alle, die weinen. Ich bete für alle, die um Freunde und Familie bangen. Ich bete gegen die Angst, den Hass, die Gewalt: Ich bete Schalom alejchem! Salem aleikum! Friede sei mit dir! Amen.«
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna
Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat
Zum Vergrößern hier klicken.
Weitere Impressionen finden Sie hier.

























































































































































































