Dreifaltigkeit statt Einfalt
Trinitatis: Unterschiedliche Meinungen, Kulturen und Lebensformen – das ist anstrengend. Doch Gott liebt die Vielfalt. Er lebt sie vor. Es ist auch ein Zeichen gegen Fundamentalismus und Terror.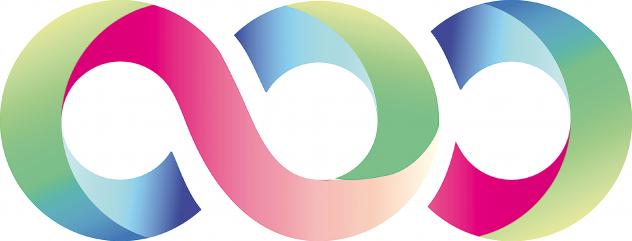
Die Welt ist bunt geworden, sagen die einen. Andere finden das bedrohlich. Menschen aus verschiedenen Kulturen mischen sich, verschiedene Religionen, verschiedene Formen von Partnerschaft und Familie. Die Verunsicherung und Angst davor ruft nach Klarheit. Und nach der Religion, selbst unter Atheisten. Stichwort Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Unter Gläubigen führt die Sehnsucht nach Klarheit in einer unübersichtlichen und bedrohlichen Welt immer öfter zu einem Phänomen, das Fundamentalismus genannt wird. Im Islamismus ist es besonders mörderisch, wie erst jetzt wieder die Anschläge von London vor Augen führten. Aber auch Christen ist es nicht fremd. Es geht um Eindeutigkeit, Einheitlichkeit. Oft kommt Einfalt dabei heraus.
Die Antwort der Bibel auf Einfalt heißt: Dreifaltigkeit. Sie klingt kompliziert, doch sie ist ganz konkret: Jesus nennt Gott »Abba, lieber Vater« – und zugleich zeigt sich Gott selbst in Jesus als liebender Mensch. Und als Heiliger Geist, der die Liebe den Menschen ins Herz gibt. Bis hin zum Kreuz und zum Schrei Jesu: »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Das alles ist Gott. Da überall ist Gott. So vielfältig. Die ersten Christen fassten es in den Segen: »Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen« (2. Korinther 13,13). Fundamentalismus klingt anders. Einfalt auch.
Theologen haben 2000 Jahre lang versucht, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Es in ein menschliches Gedankengebäude zu zwingen. Und haben doch immer nur einen Zipfel davon fassen können. Aber auch das kann den Blick öffnen. Der dreieinige Gott sei eben »kein einsamer Himmelsherr«, schreibt etwa der Theologe Jürgen Moltmann. »Der dreieinige Gott ist ein gemeinschaftlicher Gott, reich an inneren und äußeren Beziehungen. Denn Liebe ist nicht einsam, sondern setzt Verschiedene voraus, verbindet Verschiedene und unterscheidet Verbundene.«
Am Ende will Gott in Gestalt des Jesus von Nazareth wie als Heiliger Geist sogar die größte denkbare Kluft überwinden: die Sünde, das Leiden und den Tod. Luther beschrieb es so: Gott bleibt nicht bei sich, sondern setzt sich in den anderen hinein.
Und das hat handfeste Folgen. Hier und heute. »Die Trinität kann als Modell einer Verschiedenheit betrachtet werden, die die Einheit nicht zerstört, und einer Einheit, die die Verschiedenheit nicht um der Einheitlichkeit willen erstickt«, schreibt der Ökumenische Rat der Kirchen mit Blick auf die Zusammenarbeit unterschiedlicher Konfessionen. Aber das gilt genauso für innerkirchliche Vielfalt etwa bei Streitfragen wie der gleichgeschlechtlichen Liebe.
»Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen«, schreibt Paulus (1. Korinther 12, 4-6).
Der Gott der Dreifaltigkeit liebt ganz offenbar die Vielfalt. In der »Einheit und Verschiedenheit in Gott« selbst liegt für den Dresdner Theologieprofessor Ulf Liedke auch ein Auftrag an die Christen: Menschen, die etwa wegen ihrer Armut, Herkunft, Prägung oder Behinderung oft ausgeschlossen sind, als »Gemeinschaft der Verschiedenen« aufzunehmen. So dass aus Fremden Nächste werden.
Ein hohes Ziel, das sich mit menschlichen Wünschen nach Klarheit und Vertrautheit anlegt. Wie es gelingen kann? Auch da lässt sich vom Nachdenken der Bibel über Gottes Dreifaltigkeit lernen. Ihr Blick ist nicht urteilend, sondern suchend. Und staunend über Gottes Wege. Und seine Menschen.
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna














































































































































































