Wird der Mensch zur Maschine?
Digital: Der technische Fortschritt schreitet immer schneller voran. Digitale Technik und Künstliche Intelligenz wollen den Menschen perfekter machen. Doch wo ist die Grenze und wo bleibt Gott?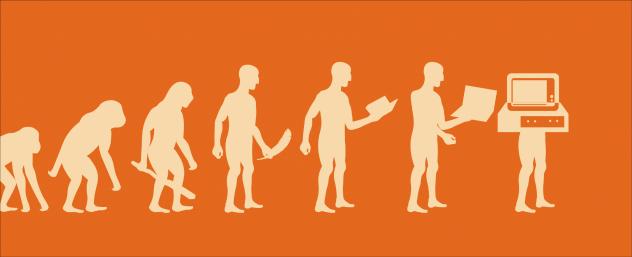
Und Gott schuf die Maschine zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie.« – so könnte Genesis 1, Vers 27 in maschinengerechter Sprache lauten. Wer glaubt, dass Menschen Maschinen sind, und sich zugleich einer christlichen Gemeinde verbunden fühlt, der wird nicht umhinkommen, über eine Anpassung der Schöpfungsgeschichte ans digitale Zeitalter nachzudenken.
Denn wenn Maschinen demnächst allgemeine Intelligenz und »Singularität« eingebaut bekommen, sollen sie angeblich ein menschenähnliches Innenleben haben. Spinnt man den Erzählfaden der Genesis von da an weiter, dann müsste diese Maschinenkreatur, kaum erfunden, verbotener Weise in einen Apfel (Apple?) beißen, aus einem Maschinenparadies (vielleicht dem Silicon Valley?) vertrieben werden und sterben können – wenn wir den Stecker ziehen oder Hacker sie lahmlegen. Aber sie sind – dem Maschinengott sei Dank – unsterblich, denn ihr Innenleben lässt sich scannen, herunterladen und neu installieren.
Das klingt absurd. Aber die Gemeinde derjenigen, die spiegelbildlich den Menschen selber für eine Maschine halten, wächst. Vor allem unter technikaffinen Zeitgenossen erfreut sich diese These großer Beliebtheit. Maschinen kann man programmieren, man kann sie steuern. Ist der Mensch eine Maschine, dann lässt auch er sich immer perfekter steuern. Daraus wurden Geschäftsmodelle, die derart erfolgreich sind, dass die so entstandenen Aktiengesellschaften zu den teuersten der Welt gehören. »Nudging« oder »Herding« nennen die Techniker dieser Konzerne eine derartige Steuerung, die den Menschen »Schwarmverhalten« einüben lässt. Wie viele Kauf- und vor allem auch Wahlentscheidungen in den letzten Jahren auf der Grundlage derartiger Steuerungstechniken getroffen wurden, ist schwer einzuschätzen.
Das Ebenbild Gottes steht unter Manipulationsverdacht. Entweder ist es der Mensch als IT-Techniker, der manipuliert, oder er ist als User (Nutzer der Technik) selber Opfer von Manipulation. Immer mehr Demokratien geraten von Wahlperiode zu Wahlperiode in Schieflage, wenn nicht bald »gegen-gesteuert« wird. Vor zwei Jahren haben deshalb 24 Bürger der ehemaligen DDR, die 1989 auf die Straße gegangen sind, ein Manifest verfasst unter dem Titel »Der Mensch ist keine Maschine.« Sie sehen heute die Demokratie wieder in Gefahr – freilich auf andere Weise als vor 30 Jahren.
Ein Bereich, der bisher noch relativ frei von derartiger Steuerung war, ist die Schule. Aber das soll sich gerade ändern. Milliarden stellt der Staat bereit, damit jetzt auch in den Klassenzimmern Digitaltechnik in großem Umfang zum Einsatz kommen kann. Wenn dies geschieht, damit von Fall zu Fall bisherige Lern- und Bildungsprozesse ergänzt und verbessert werden, ist das gut. Wenn es aber erfolgreiche Lern- und Bildungstraditionen ablösen soll, dann ist das schlecht. Denn Lernen ist ein soziales Phänomen, die Schule nach dem Elternhaus die wichtigste Sozialisationsinstanz – aber nur, wenn in ihr noch miteinander im Klassenverbund gearbeitet wird und nicht jeder Schüler sich in sein personalisiertes Lernprogramm verabschiedet.
Gute Schulbildung ist traditionell ein Herzensanliegen der evangelischen Kirche. Martin Luther war immerhin der erste, der in Deutschland die allgemeine Schulpflicht forderte. Deshalb erstaunt es sehr, dass so wenige evangelische Christen sich in die Diskussion einmischen, auf welche Weise und in welchem Umfang Digitaltechnik in der Schule zum Einsatz kommen soll. Das sollten wir ändern.
Gottfried Böhme war über 40 Jahre lang Lehrer in West und Ost und initiierte das Manifest »Der Mensch ist keine Maschine«. Im März erscheint sein Buch »Der gesteuerte Mensch? Digitalpakt Bildung – eine Kritik« (Evangelische Verlagsanstalt).
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna















































































































































































