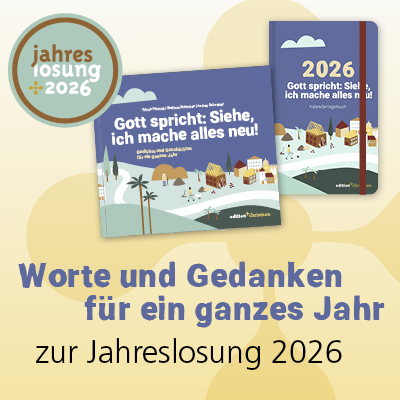Wann ist Weihnachten vorbei?
Kirchenjahr: Weihnachten endet ab diesem Jahr konstant am 2. Februar. Damit wird das kirchliche Festjahr vereinheitlicht – und ökumenischer. Ein Blick in die Architektur des kirchlichen Festkalenders.
Was den Beginn der Weihnachtszeit angeht, herrscht Klarheit. Wenn uns schon Ende September in den Supermärkten Schokoladenweihnachtsmänner anlachen, empören sich manche Christen: Das ist zu früh! Die Weihnachtszeit beginnt am 1. Advent und nicht, wenn die Schokoladenindustrie und der Handel den Umsatz ankurbeln wollen.
So eindeutig der Beginn der Weihnachtszeit ist, so unterschiedlich sind die Auffassungen über deren Ende. Wann ist es Zeit, den Herrnhuter Stern abzuhängen und die holzgeschnitzte Krippe einzupacken? Am Dreikönigstag, dem 6. Januar oder zu Lichtmess am 2. Februar – oder gar noch später? Bisher markierte der Sonnabend vor dem Sonntag Septuagesimae das Ende der Weihnachtszeit, also jährlich ein anderer Zeitpunkt. Mit dem Kirchenjahr 2018/19 ändert sich diese Ordnung, erklärt Professor Alexander Deeg, Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts in Leipzig. »Die Idee war, die Epiphaniaszeit/Weihnachtszeit ›stabil‹ zu halten. Als Termin bot sich der 2. Februar an«, so der Theologieprofessor.
Damit jeder weiß, wann die erzgebirgischen Holzkrippen und die Lausitzer Glaskugeln in Kartons gehören, steht der Termin für das Ende der Weihnachtszeit ab 2019 fest: konstant am 2. Februar.
Insgesamt ist die Datierung der kirchlichen Feiertage durchaus komplex. Die Termine für Weihnachten und Epiphanias stehen fest im Kalender: 25. Dezember und 6. Januar. Aber der Ostertermin ändert sich von Jahr zu Jahr. Er ist abhängig vom ersten Frühlingsvollmond, der in diesem Jahr am 19. April ist: Der Ostersonntag ist dann immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond – in diesem Jahr der 21. April. Der Frühlingsvollmond ist der erste Vollmond nach dem 20. März. Der Termin liegt jährlich zwischen dem 21. März und dem 19. April. Damit ist das frühestmögliche Osterdatum der 22. März, das späteste der 25. April.
Wenn nun aber der Ostersonntag zwischen dem 22. März und dem 25. April datiert ist, gibt es unterschiedlich viele Sonntage in der Zeit zwischen Weihnachten und Ostern. Die sechs Passionssonntage vor Ostern wiederum – Invokavit, Reminiszere, Okuli, Lätare, Judika, Palmarum – stehen fest. Bisher gab es dann noch vor Invokavit drei feste Sonntage vor der Passionszeit: Septuagesimae, Sexagesimae und Estomihi.
Je nachdem, ob Ostern auf einen frühen oder späten Termin fällt, dauert die Epiphaniaszeit mal länger, mal kürzer. Der letzte Sonntag nach Epiphanias, der die Weihnachtszeit abschließt, lag bisher immer vor Septuagesimae. Weihnachten endete also bisher am Sonnabend vor Septuagesimae.
Der kirchliche Festtagskalender, gültig ab 1. Advent 2018, hält demgegenüber eine Neuerung bereit: Der Weihnachtsfestkreis schließt sich konstant zu Lichtmess am 2. Februar. Im Bewusstsein vieler Menschen ist dieser Termin, der »Tag der Darstellung des Herrn« als Ende der Weihnachtszeit fest verankert. Das für diesen Tag vorgesehene Evangelium (Lukas 2,22–24) berichtet, wie Jesus 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht wird, »um ihn dem Herrn darzustellen«.
Wie Alexander Deeg ergänzt, geht der Begriff Lichtmess zurück auf den mittelalterlichen Brauch, die bei Prozessionen und Umzügen mitgetragenen Kerzen zu weihen. In der Reformationszeit sei an Lichtmess als dem Abschluss des Weihnachtfestkreises festgehalten worden. Zudem markierte das Datum auch den Beginn des bäuerlichen Jahres.
Wenn nun wieder für die evangelischen Kirchen Weihnachten mit Lichtmess seinen Abschluss findet, werde an ökumenische Traditionen angeknüpft, so Deeg. Und es wird in einer Zeit, in der alles beliebig ist, ein Fixpunkt gesetzt, der Orientierung schenkt.
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna